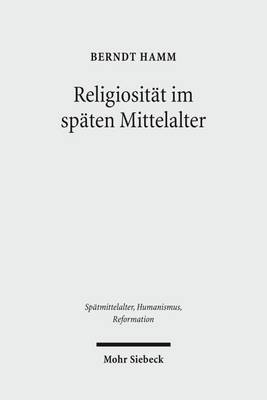Spatmittelalter, Humanismus, Reformation / Studies in the Late Middle Ages, Humanism, and the Reformation
2 primary works
Book 25
Am Beispiel des Nurnberger Ratsschreibers Lazarus Spengler (1479-1534) untersucht Berndt Hamm die Zusammenhange von Humanismus und Reformation, burgerlicher Religiositat und christlichem Glauben, Bekenntnis und Politik, biblischer Normierung und oeffentlicher Rechtsbegrundung. In zehn Studien beleuchtet er einerseits Spenglers soziales, kulturelles und reformationsgeschichtliches Umfeld, andererseits seine Person selbst: z.B. als Freund Durers und Apologeten Luthers, als fuhrenden Advokaten und Gestalter der Reformation auf Reichsebene, als theologisch versierten Reprasentanten des Laienelements in der Reformation, als Drahtzieher einer geheimen Religionspolitik der Stadtschreiber und als Pionier der reformatorischen Bekenntnisbildung. In einer Textbeilage wird erstmals das Spenglersche Familienbuchlein ediert, das von 1468 bis 1570 reicht.
Book 54
Thema des Buches sind die wechselseitigen Beziehungen zwischen unterschiedlichen Arten der froemmigkeitsnahen Theologie, der kirchlichen Seelsorge, der gelebten Religiositat, der froemmigkeitsbezogenen Bildwerke und kirchlicher Institutionen vom 14. bis fruhen 16. Jahrhundert. Die spatmittelalterliche Religiositat wird als Kraftfeld polarer Tendenzen verstanden, die teils konkurrierend gegeneinander standen, teils nebeneinander herliefen, teils miteinander kombiniert wurden. Im Blick sind insbesondere die Spannungen zwischen eher extrovertierten und eher verinnerlichenden Froemmigkeitshaltungen, zwischen einer aktiven und einer eher kontemplativ-mystischen Religiositat, zwischen einer stark vergeltungs-, lohn- und straforientierten Froemmigkeitslogik und einer Religiositat des souveranen goettlichen Erbarmens, zwischen einer angst- und furchterregenden Seelsorge und einer Seelsorge, die entangstigen und troesten will, zwischen einer stark privatisierenden und individualisierenden Froemmigkeit und einer Froemmigkeit der stellvertretenden religioesen Solidargemeinschaft der Glaubigen, zwischen einer stark klerusbezogenen und sakramentsorientierten Haltung und einer Verselbstandigung der Laienreligiositat, zwischen massiv kirchendevoten und scharf kirchenkritischen Einstellungen, zwischen einer Immediatisierung des Zugangs der Menschen zum Heil und einer Froemmigkeit der medialen Vermittlungstechniken von Gnade und Heil. Gezeigt wird, dass in der spatmittelalterlichen Theologie, Froemmigkeit und Kirchlichkeit meist mehr als nur zwei Typen eines Spannungsverhaltnisses hervortreten. Das spate Mittelalter erweist sich so als die Phase einer erstaunlichen religioesen Vielfalt und kirchlichen Spannweite. Verglichen damit ist die Konfessionslandschaft des 16. Jahrhunderts von starken Kraften normierender Reduktion und Zentrierung bestimmt.