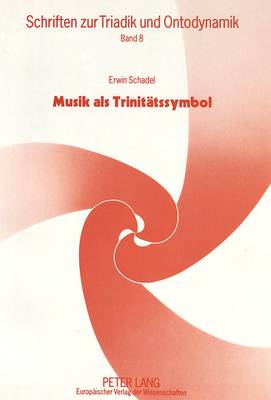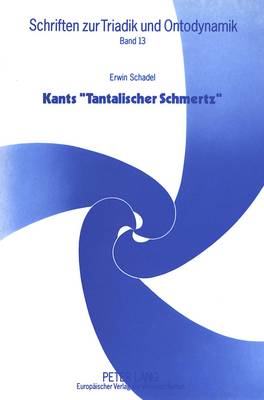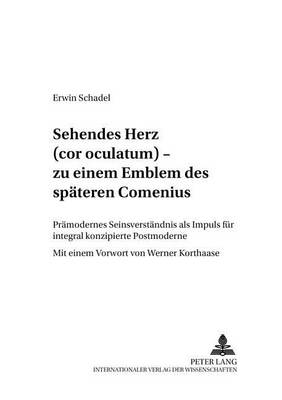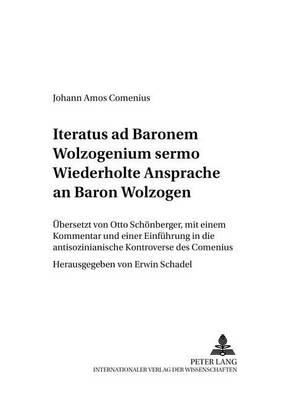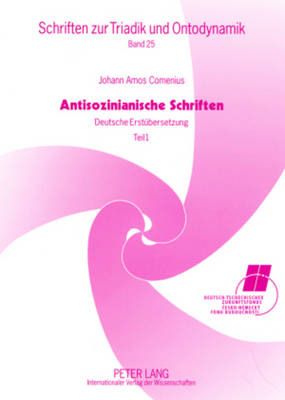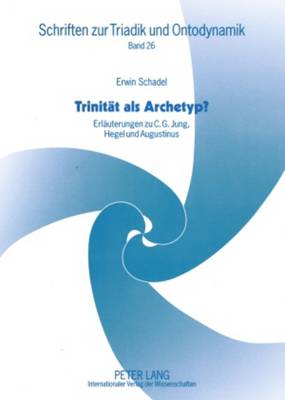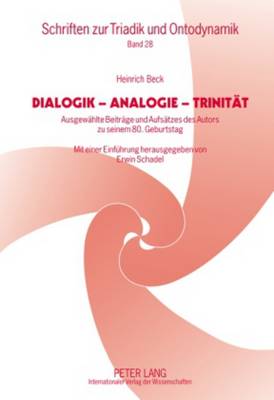Schriften Zur Triadik Und Ontodynamik
7 primary works
Book 8
Ausgangspunkt der vorliegenden Studie ist die fruhneuzeitliche Konzeption, dass der senarische Dreiklang ein Trinitatssymbol darstelle. Diese Vorgabe erfahrt in zweifacher Richtung eine systematische Vertiefung: Es kommt "erstens" zu einer Rezeption der pythagoreischen Numeralasthetik, deren Bezug zu musikalischen Elementarintervallen in den letzten Jahren vor allem vom Wiener -Institut fur harmonikale Grundlagenforschung- empirisch verifiziert wurde. Um die Aktions-Immanenz jener Intervalle als binnendifferenzierten Identitatsprozess verstehen zu konnen, wird "zweitens" der trinitatsmetaphysische Integrationshorizont rekonstruiert, welchem bei Neuplatonikern (Proklos, Dionysius Areopagita), bei Augustinus und bei mittelalterlichen Denkern (Bonaventura, Thomas v. Aquin, Cusanus) eine ontohermeneutische Bedeutsamkeit zukommt.
Die Kurzformel der "'In-ek-kon-sistenz'," welche sich in den problemgeschichtlichen Recherchen ergibt, dient schliesslich als heuristisches Prinzip dazu, 'allgemeine' Seinslehre und 'spezielle' Musiktheorie miteinander zu verschmelzen. Das Insgesamt der musikalischen Grundstrukturen lasst sich von daher als ein -archetypisches- Geflecht analogischer Triadizitat erlautern. Diese zeigt sich auf originare Weise im o.g. senarischen "Dreiklang" (in der internen Bezogenheit von Oktave, Quinte und gedoppelter Terz); sie wird jedoch auch in den beiden Dreiklangs-Derivaten sichtbar: in der "Diatonik" (welche sich in Tonika, Dominante und Subdominante ausbildet) wie auch in der "Chromatik" (welche sich aus dem Zusammenwirken des Senarischen und Diatonischen ergibt). Der in-ek-kon-sistenziale Vollzug lasst sich sogar noch im Ineinander von (vorindividueller) "Harmonik" (individueller) "Melodik" und (uberindividueller) "Polyphonie" eruieren.
Diese Studie stellt, so besehen, eine ontologisierende -Grammatik- musikalischer Grundstrukturen dar. Sie macht auf die Wirklichkeitsbedeutung des (in unserer Zeit weithin verloren geglaubten) Harmonie-Konzeptes aufmerksam. Auf distinkt-kompositive Weise erlautert sie dasjenige, was 'Tonalitat' uberhaupt ist. A-tonales Komponieren wie auch das darin zum Ausdruck kommende seins- und trinitatsvergessene Selbst- und Weltverstandnis werden von daher in Frage gestellt."
Die Kurzformel der "'In-ek-kon-sistenz'," welche sich in den problemgeschichtlichen Recherchen ergibt, dient schliesslich als heuristisches Prinzip dazu, 'allgemeine' Seinslehre und 'spezielle' Musiktheorie miteinander zu verschmelzen. Das Insgesamt der musikalischen Grundstrukturen lasst sich von daher als ein -archetypisches- Geflecht analogischer Triadizitat erlautern. Diese zeigt sich auf originare Weise im o.g. senarischen "Dreiklang" (in der internen Bezogenheit von Oktave, Quinte und gedoppelter Terz); sie wird jedoch auch in den beiden Dreiklangs-Derivaten sichtbar: in der "Diatonik" (welche sich in Tonika, Dominante und Subdominante ausbildet) wie auch in der "Chromatik" (welche sich aus dem Zusammenwirken des Senarischen und Diatonischen ergibt). Der in-ek-kon-sistenziale Vollzug lasst sich sogar noch im Ineinander von (vorindividueller) "Harmonik" (individueller) "Melodik" und (uberindividueller) "Polyphonie" eruieren.
Diese Studie stellt, so besehen, eine ontologisierende -Grammatik- musikalischer Grundstrukturen dar. Sie macht auf die Wirklichkeitsbedeutung des (in unserer Zeit weithin verloren geglaubten) Harmonie-Konzeptes aufmerksam. Auf distinkt-kompositive Weise erlautert sie dasjenige, was 'Tonalitat' uberhaupt ist. A-tonales Komponieren wie auch das darin zum Ausdruck kommende seins- und trinitatsvergessene Selbst- und Weltverstandnis werden von daher in Frage gestellt."
Book 13
Acht Jahre nach Beendigung seines -kritischen Geschafts- schreibt Kant an den befreundeten Christian Garve, dass er von einem "-Tantalischen Schmertz-" wegen der nicht erlangten Einsicht in das -Ganze der Philosophie- gequalt werde. Diese Studie (ein erweiterter Habilitationsvortrag) versucht, jenen "Schmertz" in stetem Bezug zu Kantischen Schriften zu diagnostizieren und Vorschlage zu seiner Linderung zu unterbreiten. Kants Mitteilung, dass sein Kritizismus von der -Idee des Ganzen- und der wechselseitigen Beziehung seiner Einzelmomente geleitet werde, wird zum Anlass, in umfangreichen ideengeschichtlichen Recherchen bei vornehmlich -vorkritischen- Autoren (wie z.B. "Platon, Aristoteles, Augustinus, Thomas von Aquin, Cusanus, Comenius" und "Leibniz") die Struktur relational-subsistenter Ganzheitlichkeit ausfindig zu machen. Die Einsicht in diese Struktur erlaubt es u.a., die quaestio vexata der Kantforschung - die Erlauterung der Kategorientafel - in sprachontologischer Perspektive einer Losung zuzufuhren. Durch den akt-theoretisch aufgehellten Zusammenhang von "Seins-, Erkenntnis-" und "Handlungs-"Momenten wird es zudem moglich, die wechselseitige Beziehung der drei Kantischen Kritiken als Ganzheit zu erfassen. Die These ist, dass eben dadurch das positive Grundanliegen des Kantischen Kritizismus - der (von Hume ausgeloste) Versuch einer "Widerlegung des Skeptizismus und Indifferentismus durch Erneuerung der Metaphysik" - zur Entfaltung gebracht wird.
Die Studie ist eingebettet in ideengeschichtliche Vor- und Nachbemerkungen: Auf bisher fast unbekannten doxographischen Bahnen wird zunachst - durch die Darstellung des antitrinitarischen Sozinianismus - eine -Aufklarung- des Zustandekommens der Aufklarungsphilosophie unternommen. Die abschliessenden Erlauterungen wollen zeigen, dass Kant zu Unrecht als -Kronzeuge- des postmodernen Rationalitaten-Pluralismus zitiert wird, sondern (was vor allem in der Durchmusterung der Habermasschen Kantrezeption herausgearbeitet wird) ein beachtliches Potential fur ein integrales Selbst- und Wirklichkeitsverstandnis aufzuweisen hat."
Die Studie ist eingebettet in ideengeschichtliche Vor- und Nachbemerkungen: Auf bisher fast unbekannten doxographischen Bahnen wird zunachst - durch die Darstellung des antitrinitarischen Sozinianismus - eine -Aufklarung- des Zustandekommens der Aufklarungsphilosophie unternommen. Die abschliessenden Erlauterungen wollen zeigen, dass Kant zu Unrecht als -Kronzeuge- des postmodernen Rationalitaten-Pluralismus zitiert wird, sondern (was vor allem in der Durchmusterung der Habermasschen Kantrezeption herausgearbeitet wird) ein beachtliches Potential fur ein integrales Selbst- und Wirklichkeitsverstandnis aufzuweisen hat."
Book 21
"Sehendes Herz" (Cor Oculatum) - Zu Einem Emblem Des Spaeten Comenius
by Erwin Schadel
Published 8 July 2003
Wahrend seiner Amsterdamer Auseinandersetzung mit den antitrinitarisch argumentierenden Sozinianern veroeffentlichte der mahrische Pansoph Johann Amos Comenius (1592-1670) ein Emblem, auf welchem er in Taube, Eule und Adler drei verschiedene Weisen menschlichen Selbst- und Weltverstandnisses veranschaulicht. Das 'augenlose Herz' und das 'herzlose Auge' werden dabei auf positive Weise im 'sehenden Herz' (cor oculatum) synthetisiert. Die vorliegende Studie will der historischen und systematischen Interpretation des genannten Emblems dienen. In ideengeschichtlichen Vorrecherchen weist sie auf die Notwendigkeit einer "Aufklarung" rationalistischer Aufklarungsphilosophie hin. Der Hauptteil dient dazu, das Emblem in seiner "archetypisch"-interkulturellen Bedeutsamkeit zu erlautern. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Licht- und Sonnen-Symbolik, deren UEberlieferung von Platon, uber den Neuplatonismus und mittelalterliche Autoren (bes. Bonaventura) bis zu Comenius hin nachgezeichnet wird. Im Schlussteil wird dargestellt, wie es Comenius in genuin ontologischer Argumentation gelingt, die Partizipation am "lichtvollen" Logos zum Motiv eines universal konzipierten Christentums zu stilisieren.
Book 22
Wiederholte Ansprache an Baron Wolzogen- Iteratus Ad Baronem Wolzogenium Sermo
by Erwin Schadel
Published 5 September 2002
In einem Schreiben, das 1659 an Baron Wolzogen gerichtet wurde, stellt Comenius in detaillierter Weise dar, wie er zeitlebens den Anfechtungen der die Trinitat kritisierenden Sozinianer ausgesetzt war. Das Schreiben wird hier im lateinischen Original, zusammen mit deutscher UEbersetzung und Kommentar veroeffentlicht. Hinzu kommt noch eine umfangreiche historisch und systematisch informierende Einfuhrung in acht weitere Schriften, die der in Amsterdam exilierte Bischof der Boehmischen Bruder 1659-62 gegen die Trinitatskritiker seiner Zeit herausgab. Die hier vorgestellte Studie versucht, ideengeschichtliche Zusammenhange zu beleuchten, welche von derzeitigen Philosophie- und Theologiehistorikern fast ganzlich "verdrangt" wurden. Deren unverminderte Aktualitat begrundet sich u.a. darin, dass sie im onto-trinitarischen Horizont und in universal konzipierter Logos-Christologie in der Lage sind, die fruhneuzeitliche Spaltung zwischen Glauben und Wissen zu uberwinden und wirkmachtige Impulse fur eine ontisch konsistente Postmoderne - fur eine friedvoll globalisierte Voelkergemeinschaft - darzubieten.
Book 25
Diese Ausgabe prasentiert die ideengeschichtlich kommentierte deutsche Erstubersetzung der "Antisozinianischen Schriften," welche Comenius 1659 bis 1662 in Amsterdam lateinisch veroffentlichte. Es handelt sich hier um zehn Einzelschriften. Der mahrische Pansoph fuhrt darin eine engagierte Kontroverse mit nicht weniger engagierten Sozinianern, den Trinitatskritikern seiner Zeit, welche als Vorlaufer der rationalistischen Aufklarung zu betrachten sind. Besagte Sozinianer sind Comenius von fruher Jugend an personlich bekannt. Des ofteren versuchten sie ihn, den renommierten Padagogen, auf ihre Seite zu ziehen. Er widerstand jedoch ihren Verlockungen, weil er deren Kritik an der philosophisch reflektierten Trinitat, die als erregender Anfang, gestaltende Mitte und erfullendes Ziel die ontoanalogische Basis seines universal konzipierten Reformprojektes darstellte, nicht akzeptieren konnte. Comenius hat konfessionalistisches Cliquen-Bewusstsein in sich uberwunden. Dies zeigt sich u. a. darin, dass er als Bischof der Bohmisch-Mahrischen Bruder den katholischen Raymundus von Sabunde (+1436) als Argumentationshilfe gegen die sozinianische Priorisierung der formalen Logik ins Feld fuhrt. Er uberarbeitete dessen "Naturliche Theologie" und brachte sie in gut lesbarer Fassung als "Auge des Glaubens" heraus. Was er an Raymundus besonders schatzte, war dessen neuplatonisch inspirierte Darlegung der unlosbaren Verbundenheit von Welt-, Selbst- und Gotteserkenntnis. Die Brisanz der "Antisozinianischen Schriften" besteht, allgemein gesagt, darin, dass sie einen (allzu lange) marginalisierten wirksamen Impuls zur post-nihilistischen Identitatsfindung darbieten."
Book 26
Trinität als Archetyp?; Erläuterungen zu C. G. Jung, Hegel und Augustinus
by Erwin Schadel
Published 12 June 2008
In den Essays dieses Buches geht es darum, in problemorientierter Durchmusterung dreier historisch wirksamer Denkansatze Perspektiven fur integrale Zukunftsgestaltung zu gewinnen. Thematisiert werden Carl Gustav Jung (1875-1961), der zu den Pionieren moderner Tiefenpsychologie gezahlt wird und in seinen Analysen des "Archetyps" der Trinitat ein Modell fur menschliche Selbstfindung vorlegt, der protestantische Theologe Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), der das Trinitarische im Medium seiner aprioristisch deduzierten Dialektik als die alles bewirkende Selbstentfaltung des reinen Begriffes darstellt, der lateinische Kirchenvater Aurelius Augustinus (354-430), der wahrend seiner Auseinandersetzung mit den antiken Skeptikern in menschlicher Geistinnerlichkeit das lebendig pulsierende Ineinander von Sein, Erkennen und Wollen entdeckt und diese onto-logo-ethische Ganzheit als in-ek-kon-sistenzalen Prozess erlautert, welcher, in Bedingtes und Unbedingtes spezifiziert, ein universales Format aufzuweisen hat. In ganzheitlich orientierten Eroerterungen wird die unloesbare Verflochtenheit von Welt-, Selbst- und Gotteserkenntnis hervorgehoben. Im Bezug auf Hegel und den (bisweilen) "hegelianisierenden" C. G. Jung ist dabei anzumerken, dass reines Begriffsdenken, das methodisch die Totalabstraktion alles Inhaltlichen voraussetzt, zu einer Hypostasierung des Negativen fuhrt. Die dadurch entstehenden Aporien finden eine Aufloesung, sobald die inhaltsbezogene Abstraktion rekultiviert wird und - von Augustinus her - alles Raumzeitliche in spezifisch begrenzter Teilhabe an der an sich unbegrenzten Positivitat des trikausalen Seinsgrundes betrachtet wird. Das prozess- und relationstheoretisch interpretierte Theologumenon der Trinitat lasst sich, kurz gesagt, als dasjenige auffassen, was es ermoeglicht, die in fruher Neuzeit entstandene Diastase zwischen Glaubens- und Wissensanspruchen (zwischen einem Fideismus, der nichts wissen will, und einem Rationalismus, der nichts glauben will) zu uberwinden.
Book 28
Heinrich Beck ist Jahrgang 1929, als o. Professor Inhaber des Lehrstuhls Philosophie I an der Otto-Friedrich-Universitat Bamberg bis 1997, Titular- und Honorarprofessor an sechs weiteren Universitaten in Europa und in Amerika, Dr. h.c. in Buenos Aires, Mitglied der Europaischen Akademie der Wissenschaften und Kunste, Korrespondierendes Mitglied der Koeniglichen Spanischen Akademie der Wissenschaften, Trager des deutschen Bundesverdienstkreuzes. Zentrum und Schlussel seines philosophischen Denkens ist eine trinitarische Ontologie, die vor allem von Thomas von Aquin und Hegel inspiriert und zum christlichen Glauben hin offen ist. Die von ihm in systematischen Analysen immer wieder aufgedeckte 3-gliedrige Bewegungsstruktur der Wirklichkeit unterscheidet und verbindet die einzelnen Bereiche des Seins. So gelangt er zu einer Seinsauffassung, die weder absoluten Monismus noch absoluten Pluralismus besagt, sondern vielmehr ein Mittleres zwischen beiden begrundet, namlich eine gestufte AEhnlichkeit (Analogie) in Wechselbeziehung und Auseinandersetzung (Dialog). Damit versucht er, zur Bewaltigung von zentralen Problemen und Herausforderungen der aktuellen philosophischen Diskussion beizutragen. In diesen Zusammenhang fallt auch sein langjahriges, in weltweiter Zusammenarbeit betriebenes Forschungsprojekt: "Kreativer Friede durch Begegnung der Weltkulturen", das er durch die Erfahrung zahlreicher Forschungs- und Vortragsreisen konkretisiert hat; er gilt heute als einer der Begrunder und Nestoren der interkulturellen Philosophie. Der vorliegende Band will durch die Auswahl von 30 Aufsatzen einen reprasentativen UEberblick uber seine akademische Lehr- und Forschungstatigkeit vermitteln. Dabei soll die Vielfalt seiner Arbeitsbereiche zum Ausdruck kommen. Sie sind hier nach drei thematischen Bloecken geordnet: 1. Erziehungsphilosophie und Anthropologie, 2. Erkenntnistheorie, Ontologie, Metaphysik und Religionsphilosophie und 3. Ethik, Geschichts- und Kulturphilosophie.